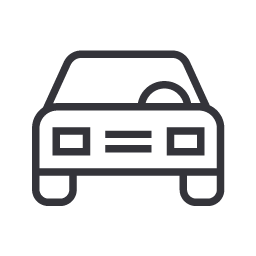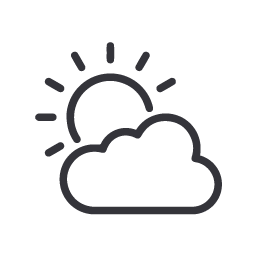Umstrittene Lösungen zur Verbilligung der Krankenkassenprämien
Die Krankenkassenprämien lasten schwer auf den Budgets vieler Haushalte in der Schweiz. Eine Volksinitiative der SP und der indirekte Gegenvorschlag des Bundesrates möchten Gegensteuer geben. An den Kostenfolgen der beiden Lösungen für den Bund und die Kantone scheiden sich jedoch die Geister.
Die Kantone sind verpflichtet, Versicherten, die in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben, eine Prämienverbilligung zu gewähren. 2019 erhielten 27 Prozent der Versicherten eine solche Verbilligung. Die Kosten dafür beliefen sich auf knapp fünf Milliarden Franken. Davon gingen rund 2,8 Milliarden oder knapp 57 Prozent zu Lasten des Bundes und 2,1 Milliarden oder gut 43 Prozent zu Lasten der Kantone. 2010 lag deren Anteil noch bei 50 Prozent.
Die im Januar 2020 eingereichte Volksinitiative der SP verlangt, dass Versicherte höchstens zehn Prozent ihres verfügbaren Einkommens für ihre Prämien aufwenden müssen. Die Prämienverbilligung soll dabei neu zu mindestens zwei Dritteln durch den Bund und zum verbleibenden Betrag durch die Kantone finanziert werden. Tiefere und zunehmend auch mittlere Einkommen könnten sich die Prämien nicht mehr oder kaum noch leisten.
Der Bundesrat lehnt die Volksinitiative „Maximal 10% des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)“ ab, stellt ihr aber einen indirekten Gegenvorschlag entgegen. Dieser sieht vor, dass die Kantone mehr Geld für die Prämienverbilligungen zur Verfügung stellen. Konkret sollen sie zu einem Mindestbetrag verpflichtet werden. Mit einem Mindestbetrag wird laut Bundesrat eine wichtige Forderung der Initiative erfüllt. Die Vernehmlassung zum Gegenvorschlag ist am Donnerstag abgelaufen.
Wenig verwunderlich, dass die Kantone dem Vorschlag des Bundesrates nicht viel abgewinnen können. Die Vorlage sei unausgewogen. Der Bund stehle sich bei der Entlastung der Kosten der Krankenkassenprämien aus der Verantwortung, schreibt die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Gesundheitsdirektoren (GDK) in ihrer Eingabe. Die zusätzlichen Kosten gingen ausschliesslich zu Lasten der Kantone.