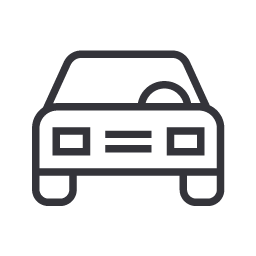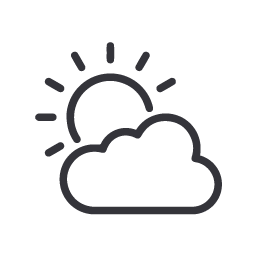Berner Oberländer Tourismusorte fürchten das «Burka-Verbot»
Berner Tourismusdestinationen – wie die Tourismusmetropole Interlaken – würden unter dem Verhüllungsverbot leiden. Darum setzt sich die Berner Tourismusorganisation Destinationen Kanton Bern für ein Nein bei der sogenannten «Burka-Initiative» ein.
Die Destinationsorganisationen des Kantons Berns und die Promotionsagentur Made in Bern AG sprechen sich gegen ein nationales Verbot der Verhüllung des eigenen Gesichts aus. Sie teilen damit die Haltung des Schweizer Tourismus-Verbandes (STV) und erachten eine verhältnismässige Umsetzung der Anliegen auf Gesetzesstufe als angemessen.
Politik ist nicht Sache der Destinationsorganisationen sowie der Promotionsagentur Made in Bern AG. Im Fall der sogenannten «Burka-Initiative» stimmt die Schweizer Bevölkerung am 7. März über eine tourismusrelevante Vorlage ab.
In mehreren Regionen des Kantons Bern gehörten Gäste aus dem arabischen Raum vor der Coronaviruskrise zu einer sehr rasch wachsenden Touristengruppe. Im Zeitraum von 2005 bis 2019 hat sich die Anzahl Logiernächte aus den Golfstaaten mehr als verdreifacht. Gerade angesichts der aufgrund vom Coronavirus sehr schwierigen Verhältnisse für den hiesigen Tourismussektor sind alle zusätzlichen Wettbewerbsnachteile zu vermeiden, die eine rasche Erholung nach der Pandemie erschweren. Nur sehr wenige Frauen unter den arabischen Gästen tragen eine Ganzkörperverhüllung (Burka oder Niqab). Die Touristen aus den Golfstaaten leisten einen positiven Beitrag sowohl zu den Logiernächten als auch zum Umsatz im Detailhandel und diversen touristischen Dienstleistungen. Die Destinationen bemühen sich in Kooperation mit ihren touristischen Partnern um eine ausgewogene Gästestruktur, die neben inländischen Gästen eine Willkommenskultur für internationale Gäste beinhaltet.
Die Destinationsorganisationen sowie Made in Bern unterstützen die Sichtweise, wonach die Probleme im Zusammenhang mit Gesichtsverhüllungen differenziert betrachtet und besser auf Gesetzesstufe auf kantonaler Ebene angegangen werden sollten.
(Text: MM/Foto: unsplash)